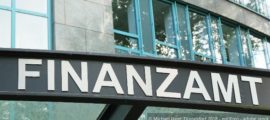Der Lebensmittelhandel hat sich auch wegen der COVID-19 Pandemie geändert. Bei solchen
Nahversorgungskonzepten stellt sich die steuerrechtliche Frage der Abgrenzung von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben zu Gewerbe- bzw. Handelsbetrieben.
Neue Ansätze für die Vermarktung regionaler Produkte, wie Selbstbedienungsläden und Containershops, erleben einen Aufschwung. Bei diesen Nahversorgungskonzepten müssen land- und forstwirtschaftliche Betriebe korrekt von Gewerbe- bzw. Handelsbetrieben abgegrenzt werden.
Direktvermarktung von eigenen Urprodukten
Aus einkommensteuerlicher Sicht gehören die Einnahmen aus der Direktvermarktung von Urprodukten grundsätzlich zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Auch wenn der Verkauf in einem eigenen Geschäftslokal erfolgt. Diese Einnahmen sind, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, mit dem pauschalen Gewinnprozentsatz (42% vom gesamten selbstbewirtschafteten Einheitswert), d.h. durch die Vollpauschalierung, abgegolten. Es besteht hinsichtlich dieser Einnahmen keine Aufzeichnungspflicht.
Kann hingegen die Teilpauschalierung angewendet werden, sind sämtliche Einnahmen (inkl. USt), auch jene aus dem Verkauf von Urprodukten, aufzeichnungspflichtig. Es können pauschale Betriebsausgabensätze (grundsätzlich 70 %) in Abzug gebracht werden.
Direktvermarktung von eigenen be- und/oder verarbeiteten Urprodukten
Die Direktvermarktung von eigenen be- und/oder verarbeiteten Urprodukten zählt steuerlich nur dann zum land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, wenn es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb handelt. Das ist dann gegeben, wenn die Einnahmen (inkl. USt) aus der Be-und/oder Verarbeitung (sowie aus Nebenerwerb und Almausschank) die Brutto-Grenze in Höhe von € 40.000 jährlich nicht übersteigen.
Der Gewinn ist (bei voll- und teilpauschalierten Betrieben) durch eine gesonderte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln. Die Betriebseinnahmen (inkl. USt) sind aufzeichnungspflichtig und die Betriebsausgaben sind mit 70% der Betriebseinnahmen (inkl. USt) anzusetzen.
Verkauf zugekaufter Waren
Werden Einnahmen auch aus zugekauften Erzeugnissen erzielt, ist ein einheitlicher landwirtschaftlicher Betrieb nur anzunehmen, wenn der Einkaufswert der zugekauften Erzeugnisse 25 % des Umsatzes des Betriebes nicht übersteigt. Ein einmaliges Überschreiten bewirkt noch keine Änderung der Einkunftsart; wird jedoch in den zwei folgenden Jahren neuerlich die Zukaufsgrenze überschritten, ist ab dem dritten Jahr von einer gewerblichen Tätigkeit auszugehen, es sei denn, die Überschreitung der Zukaufsgrenze wurde durch nicht einkalkulierbare Ernteausfälle (Frostschäden, Hagel usw.) veranlasst oder es wird glaubhaft gemacht, dass die Überschreitungen nur vorübergehend waren.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Frage, ob bei Ihnen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen. Dies kann nicht nur für die einkommensteuerliche Behandlung, sondern auch für die umsatzsteuerliche Behandlung Auswirkungen haben.